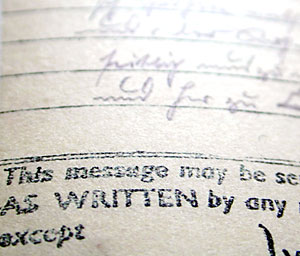1
»Es hat Einigen beliebt, mich als deutschen Künstler hinzustellen: ich protestiere feierlichst gegen diese Lüge! Was ich geworden, habe ich zunächst den modernen Franzosen von 48, dem alten & dem jungen Italien, und dann mir selbst zu verdanken – den Deutschen bleibt das Verdienst, mich zeitlebens angefeindet, und immer schlecht bezahlt zu haben« – das hat Anselm Feuerbach gesagt; auch ein großer Mann. Denn es dürfte ja schwer fallen, in so gedrängter Kürze jemals wieder so viel Ungenügendes & Verkehrtes anzutreffen, wie in dem Wort vom ‹Volk der Dichter & Denker›; Größenwahn, brusthoch, kommt angekrochen, Pfote in Pfote mit der Unwissenheit: wäre es z.B. doch sehr möglich, daß die englische Literatur, als Ganzes wie im Einzelnen, mehr Gewicht haben könnte, als die deutsche; ein Punkt, der so ausgemacht noch nicht ist, als daß er nicht noch einige Untersuchungen vertrüge. Imgrunde handelt es sich lediglich um 1 von den Floskeln, mit denen gewiegte Wahlredner die Ohren der Leute kitzeln, auf daß sie ihm ihre Stimmen geben, (worauf er ihnen dann anschließend wieder, im selben Stil, ‹politische Reife› bescheinigt) – ich will mich heut & hier der schärfsten Kriegspfad=Ausdrückungen enthalten; aber wenigstens einmal soll es ausgesprochen werden, daß ein Satz durchaus auch deswegen richtig sein könnte, weil ‹Das Volk› Ärgernis daran nimmt. Rücke ich also ganz simpel die Tatbestände etwas zurecht, und bitte den Hörer nur, to turn it over in what he is pleased to call his mind. –
Da sei zunächst, es ist am leichtesten, die schmeichelhafte Gleichung zwischen ‹Volk & Denker› aufgelöst: daß die ‹Kritik der Reinen Vernunft› bei uns so populär wäre wie Karl May, das soll man dem Juden Apella erzählen; und auch die jeweiligen deutschen Regierungen haben weder Schopenhauer noch Freud sogleich nach dem Erscheinen ihrer Hauptwerke einen lebenslänglichen Freitisch im Prytaneion ausgeworfen. Wohl aber sind mir zahlreiche Fälle bekannt, daß mit GOttes & einiger Richter Hülfe Widerrufe erzwungen, Schierlingsbecher serviert, bzw. Scheiterhaufen errichtet wurden; (aber ich will gerecht sein: zuweilen wurde dem Betreffenden, aus sonderbarer Gnade, ein Pulversäckchen um den Hals gehenkt). Zugegeben, es mag für Gläubige ebenso unheimlich wie unverständlich sein, daß notorisch große Denker die jeweils im Schwange gehende Staatsreligion immer ziemlich cavalièrement traktiert haben; und eine Wendung wie »je mehr Zeit ein Volk auf seine Religionsübungen verwendet, desto verkommener ist es« wirkt ja auch – obwohl sehrsehr nachdenklicher Aspekte fähig! – einigermaßen blasenziehend. Immerhin besteht in solchen pikanten Ausdrücken ‹die Philosophie› noch längst nicht; dergleichen ist nur das energische Ausräumen von Denkverboten, ‹Sprachregelungen› & Tabuisierungen, (mit denen interessierte Kreise bewirken wollen, daß das Volk ja nicht auch mal auf die Wahrheit reinfalle).
In Wirklichkeit handelt es sich bei der Philosophie ebenso wie bei der Hochliteratur um sehr komplizierte Spezialgebiete, die nicht nur große Begabung erfordern, sondern vor allem lebenslängliche Schulung, Fleiß & Selbstdisziplinierung; und deren Schwierigkeit nur dadurch dem Volke nicht sichtbar wird, weil es sich im alltäglichsten Umgang mit sich selbst genau der gleichen Zeichen bedient, nämlich der Buchstaben. Die unerwartet hohen Taschenbuchauflagen von Freud’s ‹Traumdeutung› oder ‹Der Witz› haben nämlich ihren Grund nicht darin, daß neuerdings die literarischen Feinschmecker und subtilen Denker plötzlich zu Hunderttausenden mitten unter uns wären; sondern beruhen schlicht darauf: daß das eine buchstäblich als Witz=Sammlung verbraucht wird; während man aus dem andern erfahren möchte, ob der brünette Herr, der Einem zwischen Uhlenflucht & Hahnenkrat durchs Kleinhirn säuselte, binnen 3 Tagen den Geldbriefträger ‹bedeutet›. Neinein: ‹Das Volk› und nicht etwa nur das deutsche, ist ungebildet und versteht nichts vom Denken.
: wohlgemerkt: ich habe kein Wort von ‹doof›, also bildungs=unfähig gesagt!
2
Bei den Schriftstellern liegt der Fall nicht anders. Auch hier wird die Einsicht in die wahren Sachverhalte, (sowie das anschließende Insichgehen), durch den Umstand erschwert, daß Jeder sich einbilden kann, er habe in der Schule ja wohl schließlich auch Lesen & Schreiben gelernt; und vor allem dadurch, daß fast nie der Unterschied zwischen ‹reiner› und ‹angewandter› Literatur gemacht wird, was sich vor allem hinsichtlich der Modernen Literatur geradezu verheerend auswirkt.
Freilich ist es auch bei den Dichtern der Älteren Schule immer so gewesen, daß die Guten unpopulär, und die Populären nicht gut waren: ‹Das Volk› hat nie Lessings theoretische Schriften zu würdigen gewußt, und nicht Klopstocks grandiose ‹Gelehrtenrepublik›; sondern währenddessen fleißig Gleich und Lafontaine verschlungen, und sich auf dem Theater Iffland angesehen – nu einverstanden!; beim Licht von Blitzen zu lesen ist nicht Jedermanns Sache; Hauptsache der Betreffende bildet sich bei solcher Gemütsbelustigung nicht gleichzeitig ein, nunmehr auf den Höhen der Kultur zu wandeln. Mein Eideshelfer sei Wilhelm Hauff, bei dem der Leihbibliothekar dem Besucher lange Reihen von Bänden zeigt: »die weißen Pergamentrücken waren so rein, als hätte man sie nie oder nur mit Handschuhen angefaßt. ‹Wer ist wohl der Autor?›. Ich riet auf eine Reisebeschreibung, oder ein naturhistorisches Werk. ‹Letzteren Artikel führen wir gar nicht›, antwortete er wegwerfend, ‹es ist Jean Paul!›. – ‹Wie?!› rief ich mit Schrecken; ‹ein Mann, der für die Unsterblichkeit geschrieben, sollte jetzt schon vergessen sein? Hat er denn nicht Alles in sich vereinigt, was anzieht & unterhält: tiefen Ernst & Humor, Wehmut & Satire, Empfindsamkeit & leichten Scherz?› – ‹Wer leugnets?› erwiderte der kleine Mann, ‹aber er hat für die Ewigkeit geschrieben: nicht für unser Volk! ›.«
Denn es hat zu allen Zeiten eben stets 2 verschiedene Literaturen gegeben; nämlich
1.) die allbeliebten guten 99% gedruckten Geschwätzes, die Wonne der Strickerinnen & Laternenanzünder, und weiter ‹hinauf›, über den ‹kaufmännischen Angestellten›, bis hin zum süßen Lesepöbel, der sich auf Ministersesseln spreizt, (und der ja sogar der mit Abstand widerlichere Typ ist). Und
2.) die wirklich ‹Große Literatur›.
Und ich zögere, das auch von meiner Ordnungsliebe geforderte=fehlende ‹1%› hinzutippen. Denn nehmen wir nur die sogenannte Bundesrepublik mit ihren rund 30 Millionen Lesefähigen, zwischen 17 und 70: dann müßten das ja immer noch 300000 sein; und so viel Gute Leser hat es in 1 einzelnen Volk zu gleicher Zeit nachweislich – u.a. durch die Auflagenziffer – noch nie gegeben. Bei uns mögen es, hoffnungsvoll geschätzt, 5000 sein; d.h. auf je 10000 Menschen kommt zur Zeit 1 ernstzunehmender Leser; und selbst, ehe ein neuerscheinendes Buch ihn erreicht, vergehen erfahrungsgemäß mehrere Jahrzehnte. Auch besteht kaum Aussicht, daß der betrübliche Prozentsatz sich in unserem Jahrhundert nennenswert erhöhen werde; denn, mag auch der allgemeine Bildungsstandard meinthalben zunehmen: die gerade in vollem Aufkeimen begriffene Moderne Literatur entfernt sich zunächst in solch rapidem Tempo vom bisher auf Druckpapier Gewohnten, daß auf ein baldiges Einholen durch die Leserschaft schwerlich zu rechnen ist: die stille Hoffnung, daß ‹Dichter & Denker› mal ‹ein Volk› haben könnten, wird von Messe zu Messe unrealistischer – ich fürchte immer, die einsichtigeren unserer Kinder werden noch einmal bibbern ob des Abstandes: die Wahrheit könnte ihnen durchaus davonlaufen!
3
Als Erstes finde ich mich in der zeitraubenden Lage, beweisen zu müssen, daß es tatsächlich etwas wie eine Moderne Literatur gebe, die sich von der älteren, und auch von 99% der zur Zeit praktizierten, fundamental unterscheidet. Und da sehe ich sie schon vor mir, all die ach so con=temporisierenden Gesichtel, ob feinsinnige Lesermiene ob Kunstschwätzervisage, wie sie sich, über ihren Dünndruckband Stifter hinweg, nachsichtig=amüsiert erkundigen: »Was verstehen Sie denn unter Ihrer ‹Modernen Literatur›?«. Einem Solchen, der 100 Jahre hinter seiner Zeit zurück ist – was Er so ausdrückt: »Ich komme über den ‹Nachsommer› nicht hinweg –« – empfehle ich, und zwar allen sachlichen Ernstes, dabei zu bleiben; er kann ja noch den ‹Theuerdanck› hinzuziehen, es ist nicht schad’. Hauptsache, er erlaubt auch mir die Beteuerung, daß die Moderne Literatur sich von der Älteren Stils erheblich unterscheidet, und zwar so sehr, daß es eigentlich gar keines besonders bewaffneten Auges bedürfen müßte, um den Unterschied wahrzunehmen.
Der liegt weit weniger in dem, was dem normal=schlechten Leser das Interessanteste und eigentlich Entscheidende dünkt, nämlich ‹dem Inhalt›, jenem beliebten Cocktail aus Sternstaub & Sündertränchen; obschon auch hier eine erfreuliche Tendenz zu größerer Nabelfreiheit unleugbar ist: handelt es sich doch bei Miller wie bei Jahnn mit nichten um die möglichst pikante Abschilderung von Ereignissen zwischen Kehlkopf & Kniescheibe, auf daß der Filister sich kurzatmig=lippenleckend aufgeile; sondern weit eher um das gewaltig ehrliche Prosa=Steak ‹Eines, der sich auszog, das Gruseln zu lernen›. Vielmehr wird der Unterschied sich etwa so angeben lassen:
1.) Man schreibt langsam Prosa. Nur sie wird rhythmisch der Vielfaltigkeit der zu verschränkenden Handlungsabläufe, und sei es nur 1 einzigen Tages, annähernd gerecht; zumal wenn eben mit einer Genauigkeit & Offenheit gekoppelt, die den biologischen Gegebenheiten einigermaßen Rechnung trägt – der beliebte, angeblich so tauig=keusche Herr Stifter zum Beispiel, verrät sich schon bei einer ziemlich oberflächlichen mikroskopischen Anatomie seiner Texte: mit zwanghafter Häufigkeit, bei den unmöglichsten Anlässen, erscheinen bei ihm die Worte ‹Geschlecht› und ‹Ding› und ‹rothaarig›: die Rache des Unbewußten.
2.) Die Moderne Literatur benützt fundamental neue Erkenntnisse, was Worte & deren Folgen im Leser anbelangt; aufbauend auf Freud und dessen Vorgängern. Und endlich
3.) was das Gerüst eines Buches betrifft – also einmal die Groß=Struktur, das Fachwerk; sowie die Anordnung der einzelnen Prosaelemente an diesem Gerüst – so sind die Möglichkeiten konformer Abbildungen unserer Welt durch die bis 1890 praktizierten Formen der Älteren Schule nichts weniger als erschöpft. –
Zu Nummer 1): das Primat der Prosa zu bezetern sei professionellen Reimern überlassen die sich auch weiterhin einbilden dürfen, ‹das Höchste sey & bleybe 1 lyrisch Gedicht› – ’ch weiß nich; aber ’n büschen komplizierter scheint mir das Leben denn nu doch. Und daß ein Großroman, an den ein begabtester Autor, ein Aner myrionous, (was immer das auch bedeuten möge), 1 oder gar 2 Jahrzehnte seines einzigartigen Daseins wendet, bedeutender ausfallen müsse, als das duftigste Sonett der warzigsten Wortmetze, leuchtet dem Leser, der für sein Geld mit Recht was haben will, ja wohl auch ein. Bleiben kurz zu erläutern eigentlich nur die Pünktchen 2 und 3.
4
Seit etwa der Jahrhundertwende hat sich, wenn auch sehr zögernd und von den Betroffenen meist gar nicht gern akzeptiert, doch die Erkenntnis ausgebreitet, wie ‹Namen› mit nichten ‹Schall & Rauch› seien; sondern daß Worte uns weit nachhaltiger necessitieren, als Mann wahrhaben möchte, (schweigen wir ganz von ‹der Frau›). Und ich meine jetzt nicht das sich durch sachlich vorgebrachte Gründe überzeugen lassen – das klappt bestenfalls bei Nebensächlichkeiten – sondern wiederhole der Kürze halber das belehrende Beispiel aus Maury’s ‹Le sommeil›; wo Jener einmal im Traume auf einer Landstraße spazierte und die Kilometersteine ablas. Dann in einen Kaufladen trat, dessen Inhaber zwar mit Kilogrammgewichten handtierte; dem Träumer allerdings mitteilte, er sei jetzt aber nicht in ‹gay Paree›, sondern auf der Molukkeninsel Dschilolo; worauf M. sich bedankte und durch Lobelienbüsche davonschritt, zwischen denen General Lopez (dessen Tod er am Abend zuvor in der Zeitung gelesen hatte) auf ihn zu kam, und ihn zu einer Partie Lotto einlud – eine scheinbar läppische, ‹sinnlose› Bilderfolge.
Es sei denn, man entschlösse sich, die Zünd=Worte so zu arrangieren:
Ki lo meterstein
Ki lo grammgewicht
Dschi lo lo
Lo belien
Lo pez
Lo tto
Mit deutlicheren Distelworten: aus ‹irgendeinem Grunde› war bei Maury der mit ‹lo› etikettierte Wortballen aufgegangen; und der Traum konstruierte nun, mit größter Eilfer= & Possenhaftigkeit, etwas wie eine Bildergeschichte daraus, vergleichbar dem Schnelldichter im Tingeltangel. Und der Grund zu solchem ‹lo›=Zwang lag noch eine Etage tiefer; denn bei ‹lolo› gibt selbst der neuste=kleine ‹Klett› an, daß es sich um den Kosenamen für eine Frauenbrust handelt, und eine ‹Lolotte› ist ein Nüttchen: Maury muß, physiologisch bedingt, amouröse Regungen verspürt haben. Die ganze Erscheinung ist ebenso ‹natürlich› wie häufig, und sie besagt u.a., daß die bloße Lagerung der Worte im Gehirn uns viel mächtiger beeinflußt, als vergangene, relativ unerleuchtete, Jahrhunderte ahnten. Auch im Wachzustand werden sich dergleichen seeschlangige ‹Zusammenhänge› pausenlos anbieten, und einige davon auch durchsetzen; es handelt sich eben um seelische Mechanismen des Herrn Jedermann, vor denen man die Augen nicht schließen, vielmehr möglichst weit aufsperren sollte.
Denn auch das Umgekehrte wird ja nunmehr möglich: daß ein erzgeschickter Schriftsteller die nichtsahnenden Leser unauffällig mit ‹lolo›=Silben ‹unterschwellig› bearbeitet; und der Ahnungslose lobt den Losen, der ihn bewußt gelotst hat, und wundert sich womöglich noch, wieso er sich nach getaner Lektüre erotisch wohlaffektioniert erhebt. Ge= & Mißbrauch der Methode sind selbstredend nicht auf die Sexualität beschränkt, sondern erstrecken sich auf alle Gebiete menschlicher Betätigung; und ermöglichen der Modernen Literatur gänzlich neue Mittel zu feinsten, geistreichsten Anspielungen & Verknüpfungen. Ein viel beschrieenes Beispiel liefert James Joyce’s Buch ‹Finnegans Wake›; genau nach Freud’scher Traumtheorie konstruiert, gemäß welcher die Träume 1 Nacht das dringendste unerledigte Problem des Vortages aufgreifen, und es in einer Serie von Bilderfluchten, es gleichsam von vielen Seiten her ventilierend, ‹lösen›: demnach wählte Joyce sich seinen permanenten Hahnrey=Komplex; und bediente sich zur lingua=logischen Weiterbeförderung der kreiselnden Nicht=Handlung, sowie zur Anreicherung mit verräterisch=folgenreichen Doppelbedeutungen, des eben beschriebenen Aneinanderklebens der Worte. (Allerdings ist Joyce an der hier gefährlich naheliegenden Klippe zu großer subjektiver Verschlüsselung gescheitert.) Nur muß sich der Leser daran gewöhnen, daß – da die Worte selbstverständlich nicht orthografisch sondern fonetisch sortiert im Broca’schen Zentrum lagern – die normale Rechtschreibung notfalls einige Abänderungen erfahre. Wie fantastisch & tiefsinnig ist das nicht gemacht, wenn im ‹Wake›, dem verdachtsvollen Eifersuchtstraum eines Alkoholikers, dessen Gattin von einem Fremden eine Zeitung empfohlen wird, der »weekly Standerd, our verile organ, that is ethelred by all pressdom« – was, oberflächlich entziffert »die Wochen=Standarte, unser wahrheitsliebendes Organ, das von der ganzen Presse gelesen wird« bedeutet; (was es im Grunde besagt, wage ich, so wie unsre Bundesrepublik gebaut ist, gar nicht herzusetzen: der Dame wird etwas sehr=anderes offeriert!). Aber wenn auch Joyce im ‹Wake› die Grenze der Nachvollziehbarkeit durch ein Publikum mutwillig überschritten hat und etwas zu viel Ego in seinem Kosmos ist, so gibt es doch auch leichtere Beispiele; denn lange vor den bisher erwähnten – vor Maury & Freud & Joyce – hatte bereits ein Anderer den ganzen Komplex einigermaßen erkannt, theoretisch untersucht, und dann praktisch benützt. Bei dem o.a. Beispiel des ‹lolo›=Traumes nämlich hätte Männiglich – vorausgesetzt, wir lebten in einer leidlich=leidlichen, an Literatur interessierten Welt – sofort nicken & flüstern müssen: »Ähä; Carroll’sche Syzygien.«; das nämlich wäre die, historisch & sachlich exakteste, Benennung jenes, manchem vielleicht noch kurios bedünkenden Tatbestandes.
Was das speziell hier anstehende Thema betrifft, muß darauf hingewiesen werden: daß jener eigentliche Kirchenvater aller Modernen Literatur wieder mal kein Angehöriger des ‹Volks der Dichter & Denker› war; sorry. Nicht, daß ich mich darob sinnlos freute; im Gegenteil kann Niemand inbrünstiger wünschen als ich, es würde bei uns mehr & tiefer gedacht & gedichtet: Da hätte ich es nämlich auch etwas leichter! –
Man unterlasse, bitte, bevor man sich einige Wochen lang ausgiebiger informiert hat, alle Einwürfe gegen das Verfahren als solches. Es handelt sich um eine einwandfreie Bereicherung der literarischen Technik, die es, bei sorgsamer Handhabung, ermöglicht, hinter die moderne=bunte=reiche Oberflächenhandlung einen schön dazu passenden ‹Echoraum› zu blenden; den Nachvollziehenden mit diskreter Gewalt zu einem doppelten Leseglück zu zwingen.
Und wer immer noch sich zieren oder gar bestreiten möchte, sei darauf verwiesen, daß zwar die Künstler all=harmlos sind; aber z.B. die ‹Reklame› sich das Verfahren unauffälliger Bearbeitung unter vorsichtiger Aufopferung der Orthografie längst umfassend zunutze gemacht hat. Denn den brutal=einfallslosen Koofmich erkennt man daran, daß Einem sein Fabrikat, ob Zigarette ob Kugelschreiber, von der Litfaßsäule herunter von einer hübschen=dikken Puppe, mit solchen oh=lo=los, hingehalten wird; während der besser Beratene es besser mit ‹RAMA› macht: da liegt nämlich, gleich nebenan im Wort=Hort, das gute=fette ‹Rahm›, (und Einem, der englisch kann – wer könnte es bei uns nicht – fällt, in frivoleren Augenblicken, womöglich gar ein rammelndes ‹ram› ein).
5
Damit ist aber erst 1 der mehreren Kennzeichen Moderner Literatur angegeben – zu Punkt 4), dem vom ‹Fachwerk›, muß ich schon wieder eine allgemeine Betrachtung vorausschicken.
Viel Wirrnis & Feindseligkeit könnte vermieden werden, wenn die Erkenntnis Allgemeingut würde, daß man 2 große Gruppen literarischer Formung zu unterscheiden habe; nämlich
a) die ‹ältere›, von Vater Homer an. Und
b) die neuere; die, ich sagte es bereits, mit Lewis Carroll beginnt.
Die ‹ältere› – und ich möchte sofort nachdrücklichst betont haben, daß das nicht unbedingt identisch mit ver=altet zu sein braucht: Klopstocks ‹Gelehrtenrepublik› ist heute noch 1. Garnitur! – hat zum strukturellen Kennzeichen, daß die von ihr benützten literarischen Formen zum größten Teil gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechen, wie sie sich organisch im Lauf der Jahrtausende herausgebildet haben. Anekdote, Novelle, Roman sind strukturell nur durch ihren Umfang unterschieden; genetisch ahmen sie sämtliche ‹den Erzähler im lauschenden Hörerkreise› nach. Das Gespräch, in Rede & Wider=Rede, ergab die Form des ‹Dialoges›; ideal, um 1 Fragenkomplex von mehreren Seiten her anzuleuchten; (wobei die technische Voraussetzung jedoch die ist: daß die Partner den gleichen Ort, dieselbe Stunde, das gleiche Thema miteinander teilen!). Als die Zivilisation vorschritt und man ‹die Post› erfand, wurde die hier nächst=raffiniertere Technik möglich, der ‹Briefroman›; obwohl hier der ‹lag› und die 2 verschiedenen Lebensbereiche wesentlich größere Kunst erfordern. 1 Mal wurde auch innerhalb dieser älteren Gruppe ein Schrittchen getan, den Circulus gesellschaftlicher Gepflogenheiten zu verlassen: einzelne kühne Geister probierten das ‹Tagebuch›, und machten so den ersten schüchternen Versuch zur Bewältigung innerer, subjektiver Vorgänge. Alle beschriebenen Gerüstformen sind auch heute noch dort am Platz, wo es sich um die optimale Erledigung bestimmter, vom Thema geforderter Verhältnisse handelt: wenn ich 2 verschiedene Personen, mit ihren 2 verschiedenen Erlebnisreihen, in 2 verschiedenen Landschaften angesiedelt, miteinander in Verbindung zu setzen habe, dann geschieht das auch heute & für absehbare Zeit noch, vermittelst des Briefromans; obschon die Oberflächenbehandlung der einzelnen Prosaelemente – im Sinne der Polyvalenz der Worte und ihrer Schreibung – heute eine sorgfältigere, geschicktere zu sein hätte. (Wieland’s ‹Aristipp› wird hier immer ein vom Fachmann genau durchzustudierendes Modellobjekt bleiben.) Das allerdings ist eine ganz andere Frage, steht auf einem ganz anderen Blatt, und scheint mir ein weiterer der Scheidewege, vor dem ‹Das Volk› heute brabbelnd & keifend steht; und einfach nicht das bißchen Energie aufbringt, wenigstens probeweise einmal zu vergessen, was es bisher zu wissen geglaubt hat; um dann vielleicht eine Einsicht, die mit den eigenen Irrtümern im Widerstreit ist, meinethalben ganz langsam & pomadig, genehmigen zu können – nämlich die Frage: ob denn mit den beschriebenen älteren Formen nun nicht schon sämtliche Möglichkeiten erschöpft wären? Die Antwort lautet, man wird’s erwartet haben: »Nu selbstverständlich nich!«. –
Das ‹Tagebuch› war ein Anfang. Die organische Fortsetzung hier lautet, um ein Firmenschild zu gebrauchen, das ich allerdings nicht schätze, ‹Innerer Monolog›; also, wohl richtiger ausgedrückt, die möglichst exakte Wiedergabe des Gemisches aus subjektivem Gedanken=Dahingequirle plus Dauerberieselung durch die nicht minder rädertierig=radotierende Realität – das bis jetzt hochwertigste Modell hat Joyce mit seinem ‹Odysseus› geliefert. Da ich die ältere Gruppe als die Nachbildung gesellschaftlicher Gepflogenheiten definiert hatte, mag das am einfachsten zu merkende Hauptkennzeichen der jüngeren immerhin dies sein: daß sie sich die möglichst getreue Abbildung innerer Vorgänge unter gleichzeitiger Einwirkung der Außenwelt vorgesetzt hat; und zwar durch die jeweils gemäßeste Anordnung der Prosaelemente, wie auch durch den Feinbau der einzelnen Worte selbst; wobei das Kriterium des Gelingens die größere Annäherung an die Wahrheit, sowie die überzeugende Nachvollziehbarkeit durch einen geübten Guten Leser ist. Ich betone dieses ‹Gut & geübt›! Es wäre pueril, sich einzubilden, daß man – bisher ein Leben lang gewohnt, an Krimi=Altären oder denen Jerry Cotton’s zu frönen – Moderne Literatur nun sogleich mit hohem Genuß vom Blatt zu lesen beginnen könnte: dem ist nicht so!
Ich führe hier nur ganz rasch ein paar grobe Exempel von jedermann bekannten Bewußtseinsvorgängen auf. – Da gibt es also das Gedankengebrodel in dem, durch die Realität hingetragenen Kopf. Da ist der Vorgang des Sich=Erinnerns. Da gibt es Träume, (die isoliert zu servieren anscheinend jeden Leser überfordert). Und da ist endlich das allwichtige ‹Längere Gedankenspiel›, das man wohl auch unscharf als ‹Tagtraum› bezeichnet; ich kann hier nur auf dies letztere etwas näher eingehen. Das ‹Längere Gedankenspiel› befindet sich in der Mitte zwischen Traum und Kunstwerk: was der Nacht der Traum, das ist dem Tag das Gedankenspiel. Und es handelt sich bei ihm um einen allgeläufigen, im Lauf des Lebens von Jedem hundertfältig praktizierten Vorgang: ob sich die Verkäuferin im Kaufhaus als ‹berühmte Tänzerin› imaginiert – man merkt’s an der Geste des Sterbenden Schwan’s, mit der die Ware verliehen wird – und daraus, zumal abends vorm Allein=Schlafengehen, Trost & Stärkung zieht; ob der Beamte sich zu seinem eigenen Vorgesetzten ernennt, und in schneidenden Rededuellen gehässigsten ‹Zug› in die ganze Behörde bringt; ob der Bergmann über Tage sich den schönfarbigen Prospekt einer Bau=Gemeinschaft vornimmt, und wochenlang um’s schmucke Eckcouch=Heim, fabrikneu mit Dampf am Auspuff=oben, herum lustwandelt: immer ist das Gedankenspiel einer unserer häufigsten & wichtigsten Bewußtseinsvorgänge. Und eben, sowohl infolge der Art seiner langsamen, zäh=probierenden Formung, wie auch der besonders interessanten Relation zwischen dem Individuum und der es, meist frustrierend, umgebenden Außenwelt halber, im höchsten Grade ‹literaturfähig›; ja, zuweilen selbst schon halbe Literatur.
Für den Schriftsteller bedeutet das aber praktisch: daß eine vollere, präzisere Beschreibung seines Helden aufs köstlichste durch Hinzuziehung von dessen Längeren Gedankenspielen möglich wird. Rein äußerlich dürfte es, um dem Leser das Erkennen der Umschaltung von Realität auf Gedankenspiel & wieder zurück, – also das ‹Mitspielen› – zu erleichtern, angezeigt sein, auch auf der Buchseite selbst eine Auseinanderrückung in 2 Kolumnen vorzunehmen. Wobei ich, um dem Interessierten wenigstens 1 kleine Andeutung der hier erforderlich werdenden handwerklichen Überlegungen zu liefern, darauf hinweisen möchte, wie z.B. die Überschneidung dieser beiden Textströme, die Breite des optisch=gemeinsamen Mittelstreifens, gar nicht von der Willkür des Verfassers abhängt, sondern vielmehr davon: wieweit Stimmung & Atmosfäre in beiden Erlebnisbereichen noch als ungefähr übereinstimmend angesehen werden können. Ein ‹Gefangener› wird sich, zur Austarierung seiner gedrückten Situation, ja zuweilen um nur Überleben zu können, gern Längere Gedankenspiele absoluter Freiheit suggerieren; wie es etwa so unendlich folgenreich Karl May im Zuchthaus zu Waldheim tat, (und so mancher Kriegsgefangene auch tun mußte). In solchem Fall ist der Gegensatz so gewaltig, der oberschichtige bildmäßige Zusammenhang so schmal, daß die Kolumnen weitweit auseinanderzurücken haben – daß unterschwellig dennoch die grausamste Determinierung stattfindet, daß & warum der ‹Gefangenenwärter› der Realität im Gedankenspiel beträchtlich sieghaft über die endlose rolling prairie gescheucht werden wird; daß & in welch kurioser Weise die beiden Bereiche einander gegenseitig beeinflussen & anregen – das dem Leser darzutun, indem man tausende von Fi= & Raffinessen in allen Spalten & Ritzen versteckt, und die Einzelworte, bis in die Buchstaben hinein mit Ober= und Unter=Tönen füllt: das ist Sache jahrelanger Mosaikarbeit eines hochtrainierten Verfassers. Aber ganz abgesehen noch von dem Fleiß & der Kunst, die erforderlich sind, wenn eine Arbeit der beschriebenen Art gelingen soll, setzt sie auch große Opfer an Stücken der eigenen Persönlichkeit voraus – nur so gerät das Ergebnis ‹wahr› genug – ein Akt der Selbstlosigkeit, der eine nicht geringe Anstrengung des Mutes erfordert; mit dem einzigen Zweck, die Möglichkeiten der Kunst zu erweitern, und sich der Wahrheit wieder etwas mehr zu nähern. Der Poncho unbeteiligter Anonymität, wie ihn ängstliche Verfasser zu tragen pflegen, die prinzipiell jedwede Ähnlichkeit ihrer Helden & der um jene herumliegenden Ortschaften, mit der Realität oder gar mit sich selbst, gleich auf der ersten Seite abschwören – besagter Poncho also dürfte etwas löcherig werden. Aber sich aus solchen Beweggründen ‹Blößen zu geben› – um dem Menschen den Menschen begreiflicher zu machen – ist in meinen Augen respektabler als der befördertste Gerok.
6
‹Genug nun!› wird es unwillig heißen – ‹Genug theoretisiert›, sage auch ich. Dennoch mußte es einmal, und sei es noch so flüchtig, dargetan werden, daß es außer der ‹angewandten› Literatur auch noch eine, sehr seltene, ‹reine› gibt, die buchstäblich ‹Grundlagenforschung› betreibt; die theoretische Einsichten sich erarbeitet, und anschließend mühsam einige wenige Modelle herstellt. Selbstredend wird die Konsumliteratur, vom Bodensatz der Groschenromane an, bis hinauf zu den Prosakonglomeraten Stifter’s und Goethe’s, immer den Löwenanteil der Buchproduktion stellen, was Meterzahl & Kilogrammgewicht der Bandreihen anbelangt; trotzdem sollte jeder Staat, der ein bißchen auf Reputation Wert legt; der nicht gefährlich stagnieren, und ins internationale Hintertreffen geraten, und den Anschluß an die Abbildungsmöglichkeiten der Welt durch das Wort verlieren will, sich die paar ‹Reinen›, die in jedem Volk in jedem Jahrhundert auftreten, sorgsam erhalten: was sie heute, scheinbar schrullig, treiben, wird in 100 Jahren als ‹zur Literatur gehörig› rubriziert, und in 200 Jahren als handwerklich= selbstverständliche Technik beachselzuckt werden.
Wohl ist Moderne Literatur ‹anspruchsvoll›, ist ‹kompliziert› und ‹schwer zu verstehen› – das ist ‹Das Leben› übrigens auch – aber von einem Buch, nur weil man es nicht so gemütlich wie gewohnt ‹vom Blatt lesen› kann, nun flink zu dekretieren, ‹es tauge nichts›: also das wäre einwandfrei ein Defekt im Leser!
Nein: es ist nichts mit einem ‹Volk der Dichter & Denker›; war nie etwas; und kann es nicht sein. Ist es doch, höflich ausgedrückt, eine Naivität – korrekter: eine Frechheit! – von der Kunst zu verlangen, sie habe sich, per fas et nefas, dem Nie=wo des ‹Volkes› anzupassen; umgekehrt ist es: der Einzelne, der Große Kunst verstehend genießen will, hat sich gefälligst zu ihr hin zu bemühen! Das Volk, das von sich zu rühmen wüßte, ein Prozent seiner Angehörigen seien Gute Leser –: siehe, dies wäre ein auserwähltes Volk.
Geschrieben August 1963 · Bargfelder Ausgabe der Werke Arno Schmidts III,4 S.311f.
© Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld